Veröffentlichungen des RHI
Publikationen
Finden Sie die richtigen Inhalte
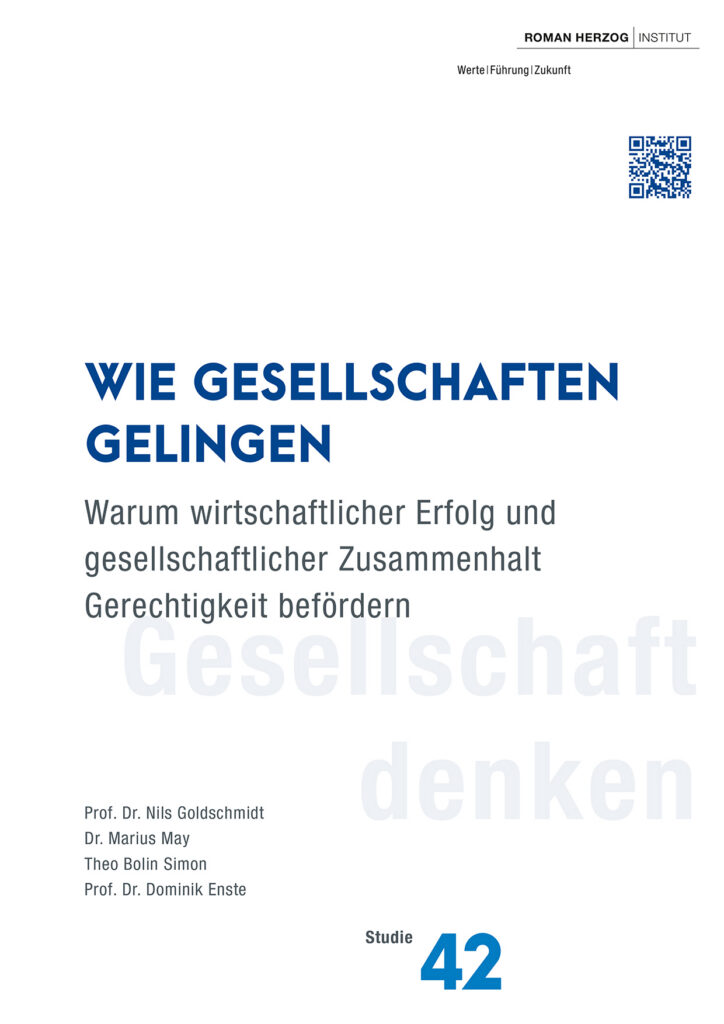
Wie Gesellschaften gelingen
Was macht eine Gesellschaft lebenswert? Neben materiellem Wohlstand ist dafür vor allem der soziale Zusammenhalt entscheidend. Denn ein starkes Wir erhöht die Motivation, sich für die Gemeinschaft zu engagieren – was sich wiederum ökonomisch auszahlt. Umgekehrt droht Ländern, denen es an sozialer Integration mangelt, auch ein Verlust an politischer Stabilität und Wirtschaftskraft. In einem internationalen Vergleich beleuchten die Autoren der vorliegen RHI-Studie diese Zusammenhänge. Sie zeigen Wege auf, wie durch gezielte Investitionen in soziale Strukturen Vertrauen, Kooperationsbereitschaft und Fairness in einer Gesellschaft gestärkt werden können, worauf es gerade in Krisenzeiten ankommt.
Zur Publikation
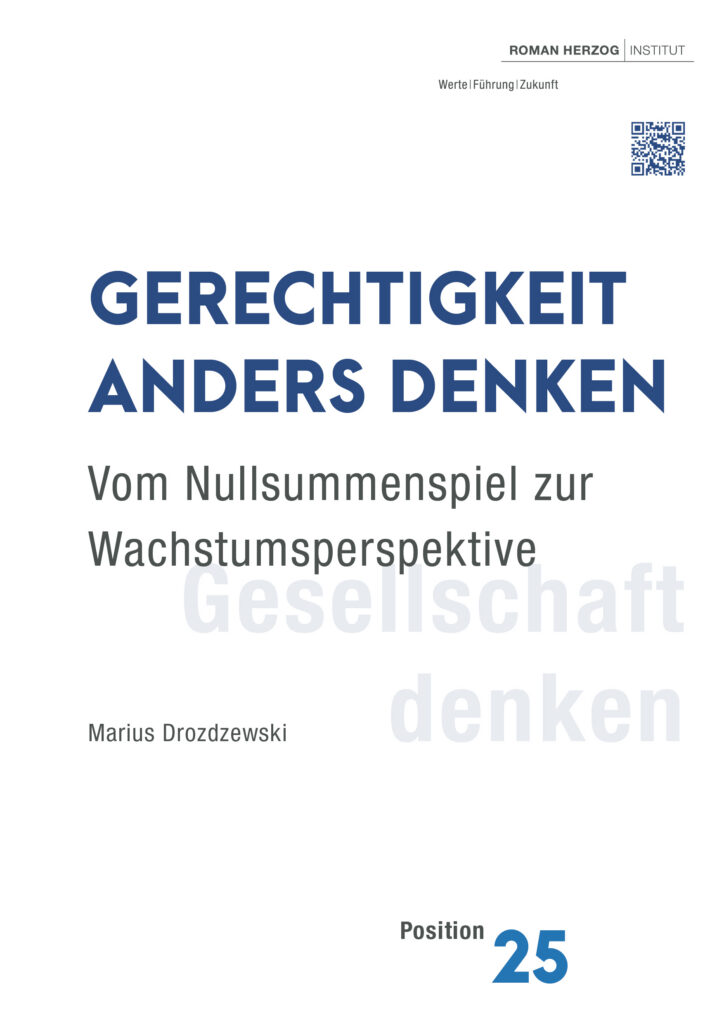
Gerechtigkeit anders denken
In einer Welt knapper Ressourcen müssen Güter, Lasten und Chancen fair verteilt werden – dieses Verständnis von Gerechtigkeit prägt unser gesellschaftliches und politisches Handeln. Danach ist Gerechtigkeit ein Nullsummenspiel, bei dem Gewinne und Verluste sich ausgleichen: Was der eine bekommt, verliert ein anderer. Der Autor Marius Drozdzewski fordert zu einer neuen Perspektive auf: Viele vermeintlich begrenzte Ressourcen können wir durch vorteilhafte gesellschaftliche Interaktion erweitern. An die Stelle erzwungener Umverteilung tritt freiwillige Kooperation – etwa durch den Tausch von Gütern und Dienstleistungen. So würde aus einer stagnierenden Gesellschaft eine, die durch Zusammenarbeit, Innovation und Fortschritt zur Gerechtigkeit wächst.
Zur Publikation
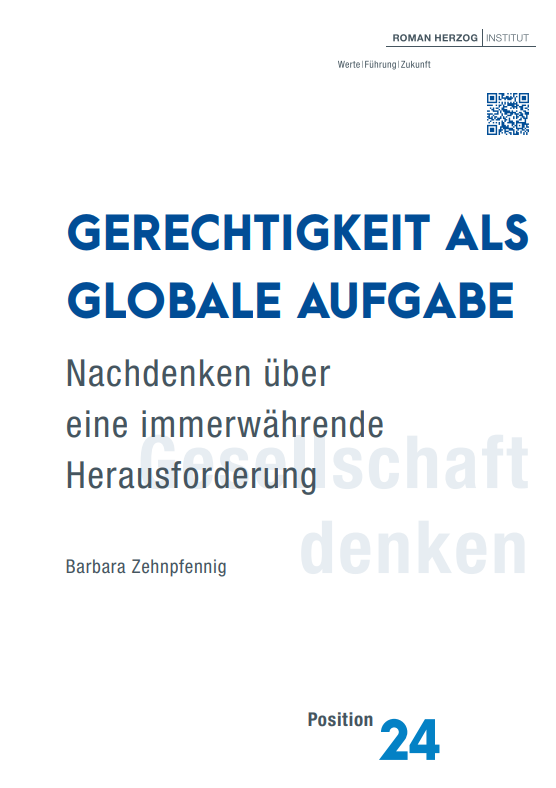
Gerechtigkeit als globale Aufgabe
Ob es um Friedensabkommen oder um Klimaziele geht: Die großen Fragen unserer Zeit sind nur im internationalen Maßstab zu lösen. Die immer enger werdende Zusammenarbeit von Staaten führt jedoch zwangsläufig zu Verteilungskämpfen – etwa bei Verhandlungen über Verteidigungsausgaben, die Aufnahme von Flüchtlingen oder die Begrenzung von CO-2-Emmissionen. Wie können gerechte Lösungen auf globaler Ebene gefunden werden? Gerechtigkeitsthemen bestimmen zunehmend die internationalen Beziehungen, sagt die Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig. In der vorliegenden Publikation skizziert sie die Konfliktlinien der aktuellen Gerechtigkeitsdebatte in den Bereichen Sicherheitspolitik, Migration und Klimaschutz.
Zur Publikation

Gerechtigkeit im Unternehmen
Ist Gerechtigkeit im Betrieb ein moralischer Luxus, den man sich leisten können muss? Nein – so der Betriebswirt und Organisationsexperte Frank Müller. Denn fühlen sich Beschäftigte, Kunden oder Lieferanten unfair behandelt, schadet dies auf Dauer der Resilienz und der Profitabilität eines Unternehmens. Mithilfe des vom Autor entwickelten „Gerechtigkeitsradars“ lassen sich systematisch Defizite im Unternehmensalltag aufdecken und positive Praktiken erfassen. Die Heuristik umfasst Gerechtigkeit auf sechs betrieblichen Ebenen in fünf Dimensionen – und zwar hinsichtlich Verteilung, Verfahren, Interaktion, Information und kultureller Diversität. Anwendungsbeispiele – etwa zu Personalmanagement, Organisationsentwicklung und strategischer Unternehmensführung – runden den praxisorientierten Leitfaden ab. Dabei stellt Müller immer wieder Bezüge zum unternehmerischen Mittelstand in Deutschland her und zeigt Wege für erfolgreiches Change-Management auf.
Zur Publikation
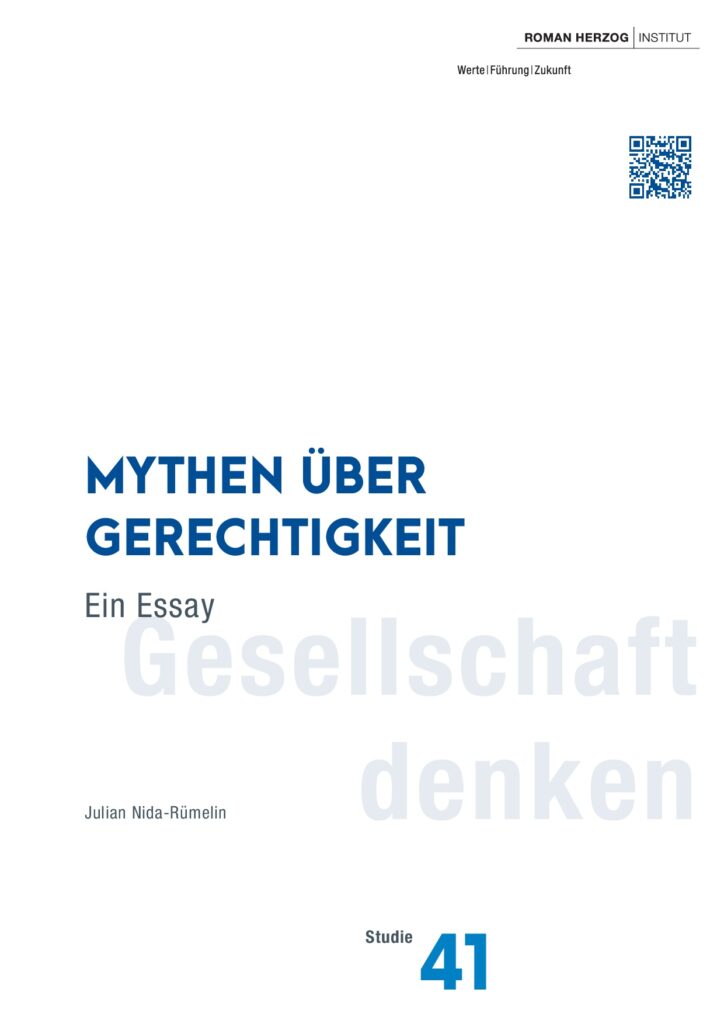
Mythen über Gerechtigkeit
Gerechtigkeit bildet die Grundlage für funktionierende politische Ordnungen und soziale Gemeinschaften. Allerdings ist die Debatte, was gerecht ist, ideologisch aufgeladen. Hier möchte Julian Nida-Rümelin die Diskussion versachlichen und zugleich Missverständnisse und Mythen beseitigen. Ihm zufolge ist es entscheidend, dass alle Menschen gleichbehandelt werden. Es geht in einer gerechten Gesellschaft also nicht um Gleichverteilung im materiellen Sinne. Vielmehr kommt es darauf an, die individuellen Rechte und Freiheiten der Menschen zu wahren und für einen fairen Ausgleich zu sorgen. In einer kritischen Betrachtung der Bereiche Wirtschaft, Bildung, Klima und internationale Beziehungen macht sich Nida-Rümelin für eine ethische Realpolitik stark: pragmatisch und an humanitären Normen ausgerichtet.
Zur Publikation

IMPULSE Spezial 2025
Die Wissenschaft hat einen hehren Anspruch: Sie strebt nach Erkenntnisgewinn, möchte neutral und zweckfrei sein. Zugleich dienen uns ihre Theorien und Ergebnisse dazu, die Wirklichkeit zu verstehen und zu deuten. In einer Zeit, in der viele Gewissheiten ins Wanken geraten, kommt es darauf an zu erkennen, wo Wissenschaft nicht nur Wissen schafft, sondern Sinn „macht“ – und wo Narrative uns zum Narren halten. Die RHI-Impulse SPEZIAL widmen sich dieser Sinnsuche – von der Theologie und Psychologie über die Demokratie- und Kommunikationsforschung bis hin zu Computerlinguistik und Critical Design. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch plädiert im Interview dafür, dass die Naturwissenschaften sich stärker soziologischen, historischen und politischen Aspekten öffnen.
Zur Publikation

Was uns Krisen lehren – und was nicht
Krisen sind ein wiederkehrendes und notwendiges Übel der ökonomischen Transformation. Diese eher unpopuläre Lehre ziehen der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe und der Ökonom Dominik H. Enste aus ihrer Betrachtung der großen wirtschaftlichen Umbrüche seit dem frühen 19. bis ins 21. Jahrhundert. In dieser Zeit wurden allmählich Instrumente der Krisenpolitik entwickelt, die sich je nach Ausgangslage und normativer Position unterscheiden (zum Beispiel Nachfrage- versus Angebotspolitik). Die Auffassung, dass staatliches Eingreifen helfen könne, Krisen zu bekämpfen, setzte sich allerdings erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollends durch. Die heutige Politik steht vor einem Dilemma: Einerseits ist sie gefordert, in der Krise unter enormem Handlungsdruck stabilisierend und steuernd zu wirken. Andererseits kann sie nur bedingt auf „Rezepte der Vergangenheit“ bauen. Denn jede Krise ist singulär und deswegen im jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext zu betrachten. Den vermeintlichen Ausweg, Wirtschaftskrisen mithilfe von Schulden zu bekämpfen, sehen die Autoren als Irrweg. Stattdessen setzen sie zur Bewältigung von Krisen auf Haushaltsdisziplin und Ordnungspolitik.
Zur Publikation

Neubeginn in der Krise
Die Allgegenwart von nationalen und internationalen Krisen erhöht den Erfolgsdruck auf die politische Führung: Sie muss Orientierung bieten und Lösungen finden. Anhand ausgewählter Beispiele aus der „Grand-Strategy-Forschung“ zeigt der Autor Benedikt Putz: Gesellschaftliche und ökonomische Umwälzungen waren zudem oft ein Motor für Fortschritt. Ein Patentrezept für den Umgang mit Krisen gibt es nicht. Denn jede Krise hat ihre Besonderheiten. Umso mehr kommt es auf gute strategische Führung an. Dies verlangt, eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen und pragmatische Lösungen zu finden. Zudem sind Beständigkeit und Weitsicht gefragt. Demokratische Gesellschaften sind auf strategische Führungskulturen angewiesen, die es den Verantwortlichen ermöglichen, langfristig zu planen und entsprechend zu handeln. Dafür ist auch ein Umdenken in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nötig. Dann können Krisen konstruktiv gestalten werden, statt nur kurzfristig auf sie zu reagieren.
Zur Publikation
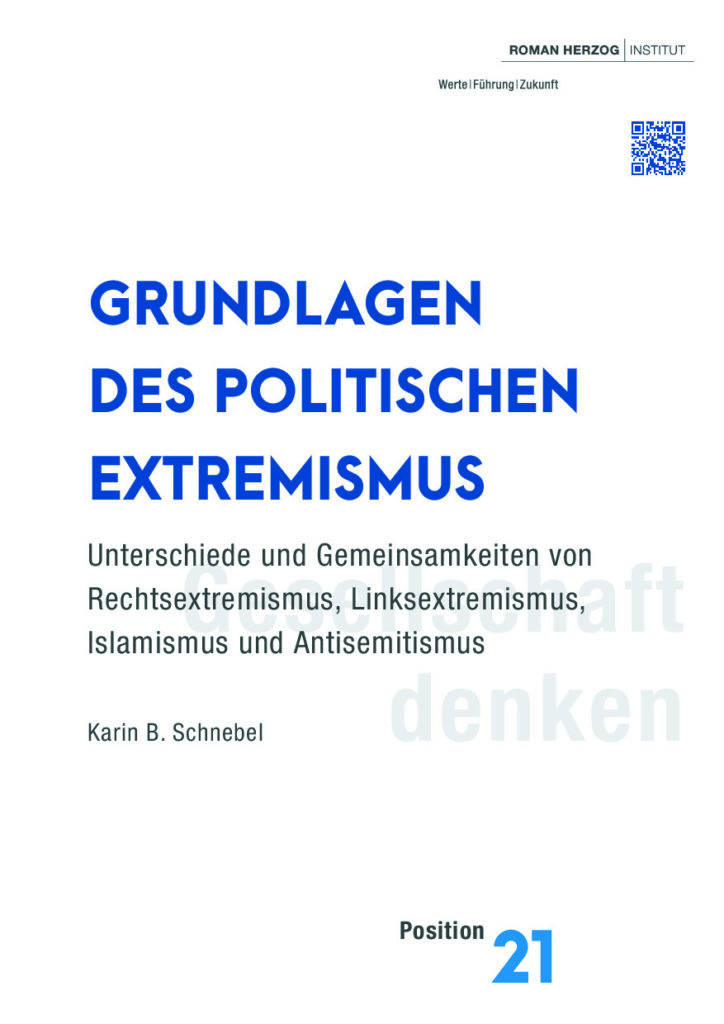
Grundlagen des politischen Extremismus
Die Demokratie schien nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland und seit der Wiedervereinigung in ganz Deutschland gefestigt zu sein. Doch inzwischen bekämpfen extremistische Gruppierungen unsere pluralistische Gesellschaft. Sie wenden sich gegen die Verfassung mit ihren Grundwerten wie Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde. Karin B. Schnebel vermittelt in dieser RHI-Position einen Überblick über links- und rechtsextremistische Bewegungen sowie verschiedene Formen des islamischen Extremismus. Dabei geht sie detailreich auf deren Entwicklungsgeschichte, ideologische Hintergründe und demokratiefeindliche Aktivitäten ein. Trotz fundamentaler Unterschiede haben rechte, linke und islamische Extremisten auch Gemeinsamkeiten. Neben ihrer Ablehnung der Demokratie und ihrem Streben nach einer – jeweils anders gearteten – neuen Gesellschaftsordnung ist dies vor allem der Antisemitismus. Darin sieht die Autorin eine besondere Gefahr – für die Existenz Israels und die Geltung der Menschenrechte.
Zur Publikation

Die internationale strategische Lage
Die regelbasierte Ordnung hat nach dem Schrecken von Nazidiktatur und Zweitem Weltkrieg für Stabilität und Sicherheit zwischen den Staaten gesorgt. Doch sie wird angesichts der massiven militärischen Auseinandersetzungen und Drohungen zunehmend brüchig. Stehen wir am Beginn einer neuen Weltordnung? Welche Rolle spielt der Westen – und welche Rolle sollte er spielen? General a. D. Klaus Naumann, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, bezieht zu diesen Fragen Position. Er zeichnet die Linien aktueller kriegerischer Konflikte nach und skizziert eine sicherheitspolitische Agenda für Deutschland und Europa. „Europa verteidigungsbereit machen“ lautet für ihn das Gebot der Stunde. Sein Debattenbeitrag reiht sich ein in den RHI-Themenschwerpunkt „strategische Führung“.
Zur Publikation

Führung in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche
Egal ob im betrieblichen, politischen oder gesellschaftlichen Kontext: In Zeiten großer Umwälzungen ist der Bedarf an guter strategischer Führung besonders groß. Doch was macht gute Führung aus? Wie kann sie gelingen? Und worauf sollte eine Führungskraft setzen, um den Wandel erfolgreich zu gestalten? Um diese Fragen zu beantworten, vergleicht Thorsten Krings zwei historische Persönlichkeiten und Umbrüche – Ludwig XVI. und die Französische Revolution sowie Nelson Mandela und die Überwindung der Apartheid in Südafrika. Seine Erkenntnis: Erfolgreiches Führen ist eng verknüpft mit der Fähigkeit, im entscheidenden Moment das Richtige zu tun. Gerade in Phasen gesellschaftlicher Instabilität kommt es auf Führungsstärke an. Dabei geht es nicht um „den starken Mann“. Gute Führungskräfte sind vielmehr Gestalter und Treiber des Wandels. Sie haben eine klare Strategie, stoßen Veränderungen an, geben Ziel und Richtung vor und motivieren andere.
Zur Publikation
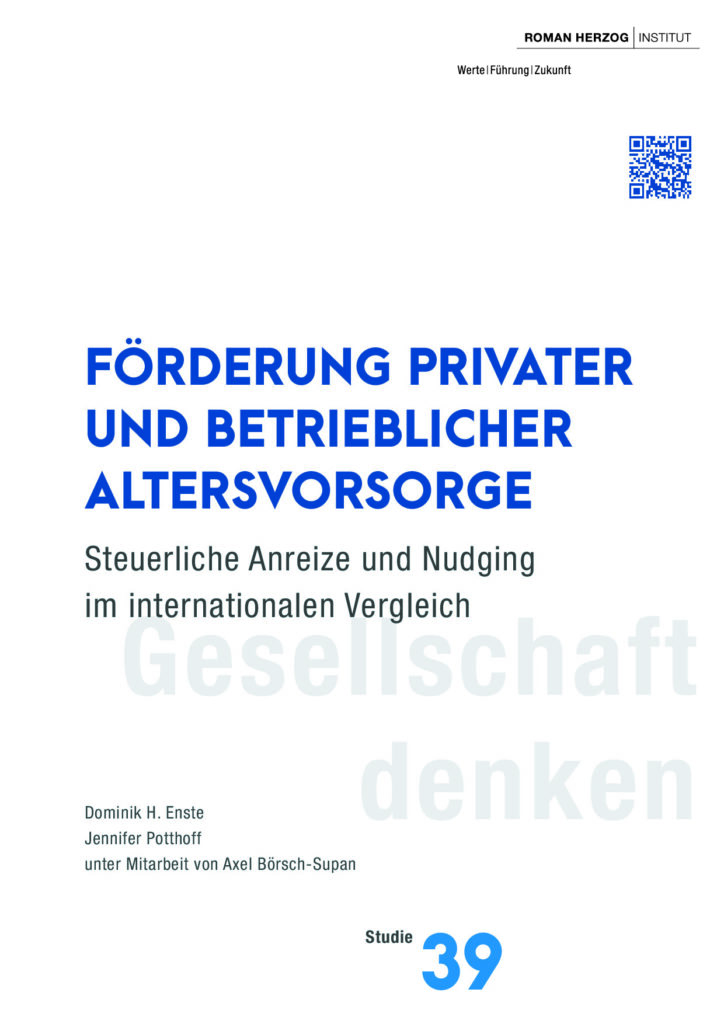
Förderung privater und betrieblicher Altersvorsorge
Vor 40 Jahren galt in Deutschland noch: „Die Rente ist sicher!“ Heute wissen wir es besser – die gesetzliche Rente reicht nicht für ein auskömmliches Einkommen im Alter. Doch diese Erkenntnis allein veranlasst die Menschen nicht, mehr privat vorzusorgen. Auch staatliche Förderung etwa der Riester- oder Rürup-Rente ist wenig erfolgreich. Und selbst jene, die es sich leisten könnten, sparen zu wenig für den Ruhestand. Woran das liegt, was man dagegen tun kann und wie andere Länder damit umgehen untersuchen Dominik H. Enste und Jennifer Potthoff. Zusammen mit dem Rentenexperten Axel Börsch-Supan loten sie das Potenzial aus, das in verhaltensökonomischen Ansätzen zur Förderung der Altersvorsorge liegt. Beispiele aus Neuseeland („KiwiSaver“), den USA („401(k)-Pläne) und Großbritannien („Automatic Enrolment“) zeigen Lösungswege auf. Alle drei Länder setzen auf Nudging, also Voreinstellungen, die gewünschtes Verhalten fördern sollen. Zum Erfolgsrezept gehört, nicht zu bevormunden und stets die persönliche Entscheidungsfreiheit zu wahren.
Zur Publikation

IMPULSE Spezial 2024
Was verbindet Biodiversität, berufliche Bildung und Unternehmensreputation? Das sind die Gewinnerthemen der Preisträgerinnen des Roman Herzog Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft 2024. Bei aller Unterschiedlichkeit geht es im Kern um Verantwortung gegenüber anderen – vor allem mit Blick auf kommende Generationen. Mit Nachhaltigkeit im umfassenden Sinn beschäftigen sich auch die weiteren Beiträge der RHI-Impulse SPEZIAL 2024 – etwa zur Sicherheit globaler Lieferketten, zur Rolle von Konzernen und Konsumenten in der Wegwerfgesellschaft oder zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm erläutert im Interview, welche Reformen unser Land jetzt dringend braucht, wenn wir unseren Wohlstand wahren wollen. Aus dem Inhalt
Zur Publikation
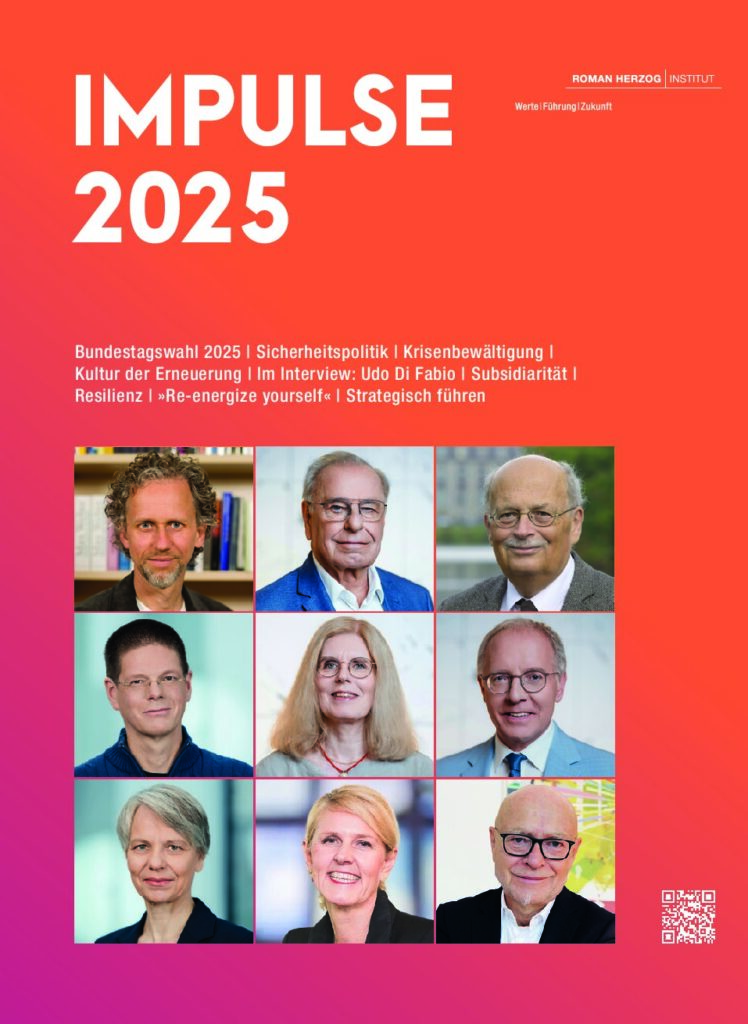
IMPULSE 2025
Das Roman Herzog Institut hat neun renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einer Bestandsaufnahme eingeladen: Sie zeigen aus ihrer jeweiligen fachlichen Perspektive auf, wie wir die gegenwärtigen Krisen und Umbrüche bewältigen können. Ihre Analysen reichen von aktuellen politischen Entwicklungen – Stichwort „Ampel-Aus“ und „Trump“ – bis hin zu konzeptionellen Überlegungen zu strategischer Führung, gesellschaftlicher Organisation sowie Selbstbehauptung und Resilienz. Sie raten zu pragmatischen Lösungen und ermuntern dazu, Neues auszuprobieren und durch Versuch und Irrtum zu lernen. Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht, Udo Di Fabio, legt im Gespräch mit RHI-Geschäftsführer Martin Lang dar, welche Herausforderungen eine neue Bundesregierung meistern muss und wie Deutschland wieder wirtschaftlich und politisch erstarken kann. Aus dem Inhalt
Zur Publikation

IMPULSE Spezial 2023
Die Soziale Marktwirtschaft prägt seit 75 Jahren das wirtschaftliche und gesellschaftliche Miteinander in Deutschland. Um ihre Ausgestaltung wird im politischen Raum stets gerungen und sie ist immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Denkanstöße zur aktuellen Diskussion bieten die RHI-Impulse SPEZIAL. Dazu hat das Roman Herzog Institut zwei renommierte Ökonomen, Michael Werding und Michael Hüther, sowie die aktuellen und ehemalige Preisträger*innen des Roman Herzog Forschungspreises zusammengebracht:
Zur Publikation

Lebensarbeitszeit im internationalen Vergleich
Viele Menschen würden gern weniger arbeiten und früher in Rente gehen. Allerdings passt dieser persönliche Wunsch nicht zur alternden Gesellschaft in Deutschland. Um den Mangel an Fach- und Arbeitskräften abzuschwächen und die Finanzierung der gesetzlichen Altersvorsorge zu stabilisieren, müsste die Lebensarbeitszeit vielmehr steigen. Wie dies gehen kann, welche Potenziale in den sogenannten Silver Workern – den 65- bis 69-Jährigen – liegen und wie Deutschland im internationalen Vergleich dasteht, damit beschäftigen sich Dominik H. Enste, Martin Werding und Julia Hensen in dieser RHI-Studie. Als empirische Basis dazu vergleichen die Autor*innen die Lebensarbeitszeit in Deutschland mit der in anderen OECD-Staaten. Sie zeigen – auch anhand von Best-Practice-Beispielen aus anderen Ländern –, wie sich Potenziale heben und das Arbeitsvolumen steigern ließen. Zudem plädieren sie dafür, die Erwerbsphase zu verlängern, indem das gesetzliche Renteneintrittsalter automatisch an die höhere Lebenserwartung wird.
Zur Publikation

Wie resilient ist die Soziale Marktwirtschaft im internationalen Vergleich?
Demografischer Wandel, Digitalisierung, Dekarbonisierung und De-Globalisierung: Angesichts dieser gleichzeitig auftretenden Herausforderungen sorgen sich die Menschen um ihre Zukunft. Sie wünschen sich Sicherheit und Stabilität. Doch ist es eher das Festhalten am Bewährten oder die Bereitschaft zur Veränderung, die uns in Zeiten großer Umbrüche stärkt? Die vorliegende RHI-Studie geht dieser Frage nach und untersucht, wie gut Deutschland mit der Sozialen Marktwirtschaft für die wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Transformation aufgestellt ist. Das Fazit der Autoren und Autorin: Die Soziale Marktwirtschaft gehört weltweit mit zu den erfolgreichsten Wirtschaftssystemen – nicht nur im Rückblick, sondern auch in der Zukunftsperspektive.
Zur Publikation
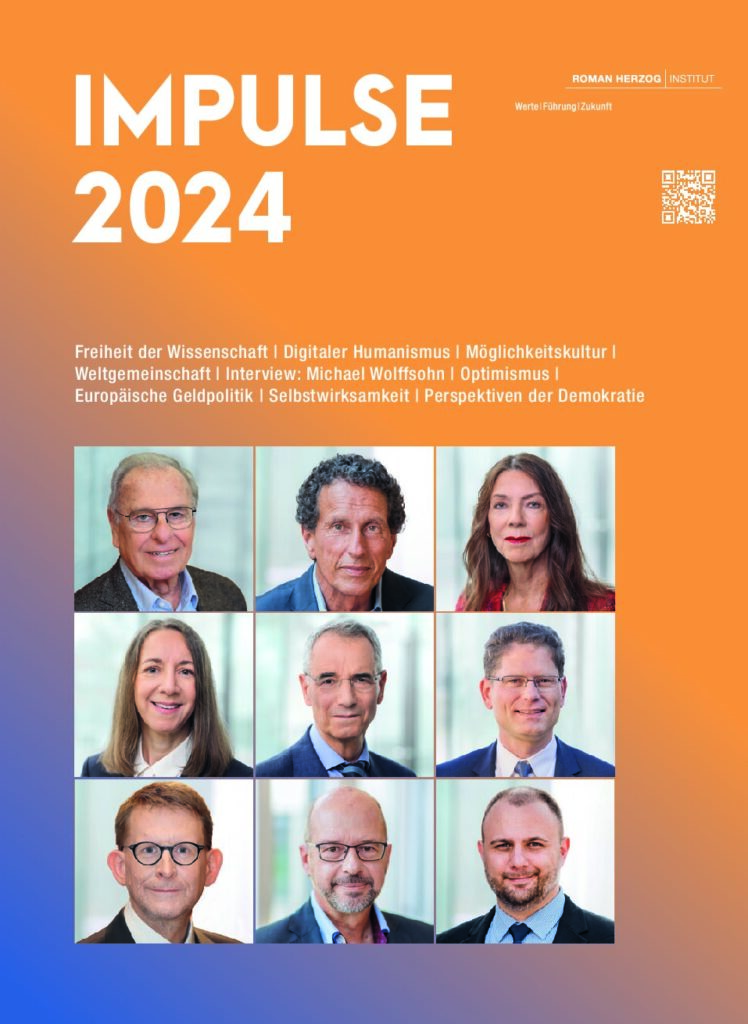
IMPULSE 2024
Ukrainekrieg und Nahostkonflikt, Energieknappheit und Inflation, Klimawandel und Migration – die aktuellen Krisenherde setzen die Politik unter Handlungsdruck. Doch welchem Kompass soll sie folgen? Und welche Orientierung kann die Wissenschaft dabei bieten? Im politischen Alltag gelten Entscheidungen oft als „alternativlos“. Wenn statt Wahlfreiheit allerdings nur noch Sachzwänge im Vordergrund stehen, schwindet das Vertrauen in die demokratischen Prozesse. Unsere Autorinnen und Autoren zeigen auf, dass dieses Vertrauen zurückgewonnen werden kann. Dafür müssen sich Menschen als selbstwirksam erfahren, mitentscheiden und politisch etwas bewegen können. Gleichzeitig warnen sie vor ungebremster Euphorie über den technischen Fortschritt. Sie fordern ethische Richtlinien für künstliche Intelligenz sowie die Besinnung auf das, was alle Menschen als Menschen miteinander verbindet. Aus dem Inhalt
Zur Publikation