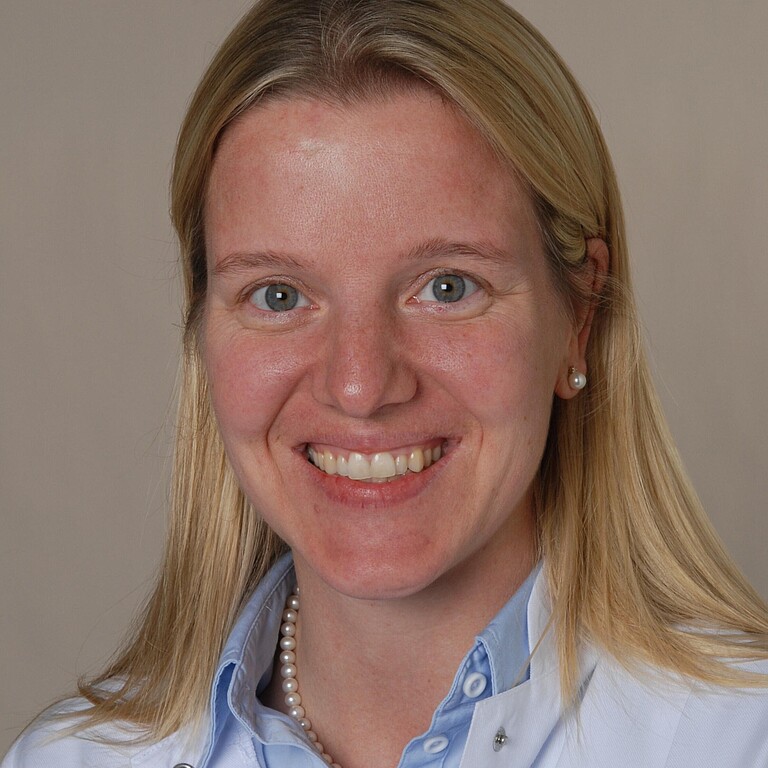
Kurzvita
Susanne A. Schneider
Kurzportrait
Nach ihrem Studium der Humanmedizin in Freiburg, London und Luzern schloss sie ein Ph.D.-Programm am UCL Queen Square Institute of Neurology in London ab. Nach ihrer Ausbildung zur Fachärztin für Neurologie in London und Lübeck wechselte sie nach Kiel und zuletzt nach München. Ihre Habilitation schloss sie im Alter von 31 Jahren im Fach Neurogenetik ab. Seit 2015 ist sie apl-Professorin für Neurologie.
Über die Expertin
Susanne A. Schneider ist Neurologin und ausgezeichnete Expertin für Bewegungsstörungen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie beschäftigt sich mit den Ursachen, Symptomen und neuen Therapien (Präzisionsmedizin) von neurodegenerativen Krankheiten. Dabei reicht ihr Forschungsgebiet von den häufigen Formen wie der Parkinson-Krankheit auf der einen Seite bis zu den sehr seltenen, vielfach erblich bedingten Krankheiten auf der anderen Seite. Im aktuellen Kontext forscht sie zu den neurologischen Spätfolgen der Corona-Krankheit (Long-Covid). Ihr Publikationsverzeichnis umfasst mehr als 200 Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Büchern. Zudem ist sie Mitherausgeberin von vier international verbreiteten Büchern. Sie wirkt in zahlreichen Gremien der internationalen Fachgesellschaften mit und ist Mitherausgeberin mehrerer internationaler Fachzeitschriften. Für ihre Forschungstätigkeit wurde sie wiederholt mit renommierten Preisen geehrt.
Weitere Wissensbereiche: Parkinson, Demenz, Erbkrankheiten, Präzisionsmedizin, Corona/Covid-19
„Corona ist bei aller Tragik zugleich auch eine Inspiration für die Forschung“
-
Frau Prof. Schneider, Sie erforschen unter anderem Erkrankungen wie Parkinson, neben der Alzheimer-Demenz zweithäufigste degenerative Erkrankung des Nervensystems. Mit welchen Fragen beschäftigen Sie sich?
Wir forschen zu den Ursachen, Symptomen und neuen Therapien sogenannter neurodegenerativer Krankheiten. Diese Erkrankungen zeichnen sich durch einen fortschreitenden unaufhaltsamen Verlust von Nervenzellen aus.
In Deutschland leiden etwa zwei Millionen Menschen an neurodegenerativen Krankheiten wie der Alzheimer-Demenz oder der Parkinson-Erkrankung. Diese Zahl nimmt auch aufgrund der steigenden Lebenserwartung stark zu und wird sich bis 2050 verdoppeln bis verdreifachen.
Bisher unklar ist, ob auch die Langzeitfolgen von Covid-19 die Zahl der Patienten mit Bewegungsstörungen und anderen neurologischen Krankheiten deutlich erhöhen werden. Neurodegenerative Krankheiten sind somit nicht nur ein individuelles Schicksal, sondern auch eine zunehmende sozioökonomische Herausforderung.
-
Prägt Ihre wissenschaftliche Arbeit auch Ihre persönliche Perspektive, also den eigenen Blick aufs Alter?
-
Die Corona-Pandemie hat der älteren Generation pauschal den Stempel einer besonders vulnerablen Personengruppe aufgedrückt. Grundsätzlich ist unser Bild vom Alter stark auf Defizite fixiert. Ist das aus Ihrer Sicht als Medizinerin gerechtfertigt?
-
Heute heißt es oft: Wir müssen – auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – die Potenziale älterer Mitbürger*innen stärker nutzen. Das Können und die Erfahrungen der älteren Generation sollen für die Gesellschaft nutzbar gemacht werden. Halten Sie diesen Anspruch für realistisch und sinnvoll?
-
Was kann die medizinische Forschung heute dazu beitragen, dass Menschen im Alter fit und leistungsfähig bleiben – oder auch trotz Krankheit und der damit verbundenen Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben führen?
-
Welche Auswirkungen hatte Corona auf Ihre Forschungsarbeit?
-
Hat die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass wir allgemein die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit neu definieren?
-
Ist das Ansehen von Wissenschaftler*innen und die Wertschätzung ihrer Arbeit in der Pandemie gewachsen?
-
Das RHI vergibt jährlich einen Forschungspreis für Nachwuchswissenschaftler*innen. Ein wichtiges Kriterium ist dabei die Verständlichkeit der Forschungsergebnisse. Wie relevant ist dieser Aspekt für Sie?
-
Ihre Forschungstätigkeit ist eng verzahnt mit anderen Fachgebieten. Wie tauschen Sie sich aus? Welchen Stellenwert hat interdisziplinäres Arbeiten für Sie?


